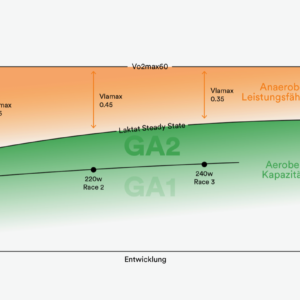Mythos Runder Tritt? Wie du tatsächlich mehr Kraft auf deine Pedalen bekommst
Mythos Runder Tritt – wie du tatsächlich mehr Kraft auf deine Pedalen bekommst. Mit der richtigen Technik und Verständnis der Biomechanik. Die Tritt-Ökonomie beim Radfahren bezieht sich auf die Effizienz, mit der du die Pedale betätigst.